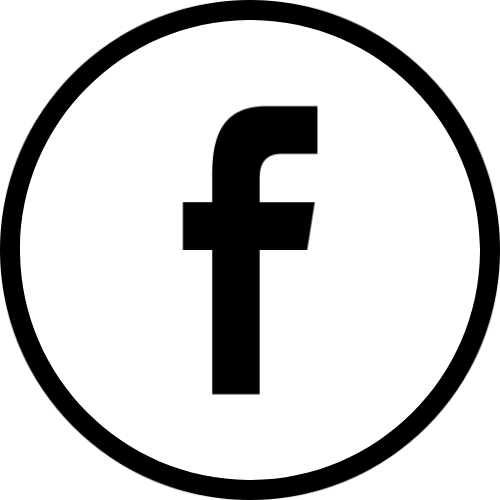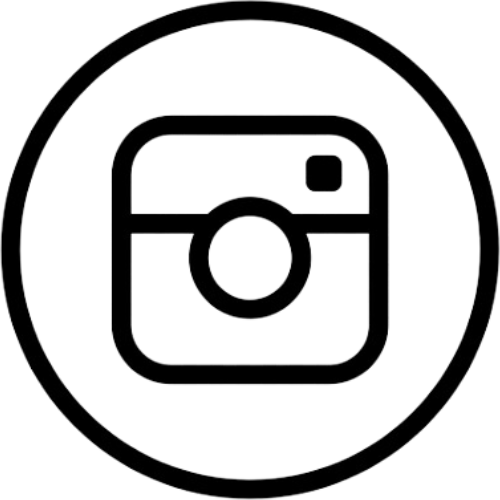De tweejaarlijkse conferentie van het European Labour History Network (ELHN) trok ook dit jaar een groot aantal onderzoekers aan uit alle hoeken van Europa, evenals uit de VS, Latijns-Amerika, Afrika en India. In Uppsala waren er bijna 250 inschrijvingen, waarvan ongeveer 50 online. Er waren 236 presentaties in 72 sessies, verspreid over drie congresdagen.
De ELHN-conferentie is daarmee een van de grootste wetenschappelijke evenementen wereldwijd in de arbeidsgeschiedenis en sociale geschiedenis. De conferentie wordt tweejaarlijks gehouden, afwisselend met de grotere (en verwante) European Social Science History Conference. Het is reeds de vijfde conferentie, na edities in Turijn (2015), Parijs (2017), Amsterdam (2019) en Wenen (2021).
Inhoudelijk weerspiegelt de conferentie het onderzoek dat verricht wordt in de twintig werkgroepen die het netwerk telt, waaronder werkgroepen rond Economic and Industrial Democracy, Memory and Deindustrialization, Feminist Labour History, Precarious Labour, Labour and Coercion, enzovoort. We konden kennismaken met vernieuwende invalshoeken zoals Historical Semantics of Coercion, The Caribbean: Bedrock of Anti-Imperialism?, Labouring Elderly, Conceptual Debates on Precarity, Recruitment and Refusal in Military Labour, Women Negotiating Change in Industrial Workplaces, enzovoort.
De conferentie werd georganiseerd door onze collega's van de Swedish Labour Movement's Archives and Library (ARBARK in het Zweeds) in samenwerking met Uppsala University. Amsab-ISG was van bij de start betrokken bij dit onderzoekersnetwerk, reeds bij de stichtingsvergadering in 2013 in Amsterdam. Amsab-medewerker Donald Weber zetelt in het ELHN-bestuur en was ook dit jaar betrokken bij de organisatie.
Een bijzonder moment tijdens de conferentie was de vertoning van de documentaire A Sad Truth (75 min.) over de deportatiekampen voor vluchtelingen die in Denemarken worden ingericht sinds 2015. Bijzonder aangrijpende getuigenissen over de uitzichtloze positie van vluchtelingen in Denemarken, die soms na vijf jaar te horen krijgen dat ze uitgewezen worden en meteen worden afgevoerd naar een gesloten kamp. Regisseur Helle Stenum was aanwezig bij de vertoning en nam deel aan een debat achteraf. Haar vorige, meermaals bekroonde documentaire We Carry It Within Us: Fragments of a Shared Colonial Past over de (post-)koloniale geschiedenis van Denemarken kan online bekeken worden. Beslist een aanrader!